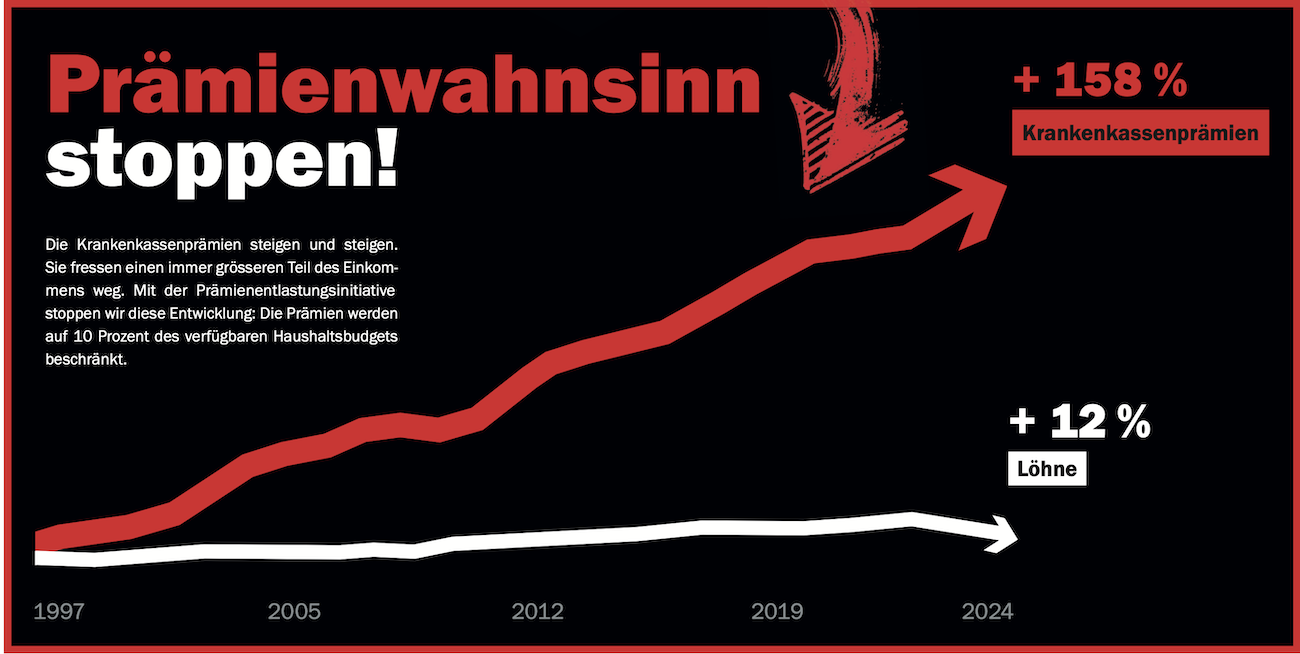Zwei Zeitzeuginnen und vier Zeitzeugen erinnern sich an die Schwarzenbach-Abstimmung vom 7. Juni 1970, als wäre es gestern gewesen. So gross war damals ihre Angst. Und so sehr traf sie die fremdenfeindlich aufgeheizte Stimmung im Land. Die zwei Frauen und vier Männer haben ihre Geschichten für ein Forschungsprojekt * der Uni Bern erzählt. work bringt sie hier stark gekürzt.

GIUSEPPE PERÓ: War Hilfsarbeiter bis 1970, danach Werkmeister bei Gutor und ABB. Seit 1986 führt er mit seiner Frau eine Parfumerie. Präsident der Christlichen Internationalen Arbeitervereinigung ACLI in Wohlen AG. (Foto: Nico Zonvi)
Giuseppe Però (70) kam 1968 aus Apulien nach Wohlen: «Danach hab ich gejubelt»
«Ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen. Wir waren neun Kinder. Uns ging es gut. Ich besuchte die Kunstschule. Zwei Jahre hätte ich noch machen müssen. Aber dann verliess uns mein Vater. Und ich ging in die Schweiz. Ich wollte meiner Mutter helfen, ihr Geld schicken. Ich war 18. Und bekam eine Stelle im Metallbau, bei Gutor in Wohlen AG. Zuerst als gewöhnlicher Arbeiter, ohne Spezialisierung und ohne Deutsch zu können. Aber ich hatte Glück: Ich konnte die Zeichnungen lesen. Und der Werkstattchef war Italiener. Das war meine Rettung. Ich besuchte Kurse, und nach einem halben Jahr wurde ich schon Vorarbeiter.
Das sahen nicht alle gern. Vor allem zwei, drei Schweizer versuchten, mir Fehler anzuhängen. Geholfen hat mir, dass ich Goalie beim FC Wohlen war. Dafür war ich bei meinen Mitarbeitern bekannt, und viele haben mich deshalb auch als Vorarbeiter toleriert.
«Wir standen da, den Oberkörper frei, 400 bis 500 Menschen in einer Reihe.»
UNSICHERHEIT. Schlimm war, dass ich Ende Jahr immer wieder nach Hause reisen musste. Ich war Saisonnier, durfte immer nur ein paar Monate bleiben. Ich wusste nie, ob ich einen neuen Vertrag bekomme und wiederkommen darf. Diese Unsicherheit war traumatisierend.
Das Schlimmste aber waren die Einreisen in die Schweiz. An der Grenze in Chiasso. Der ganze Zug wurde kontrolliert, wir mussten aussteigen, uns ausziehen und uns röntgen lassen. Es war so kalt. Wir standen da, den Oberkörper frei, 400 bis 500 Menschen in einer Reihe. Dieses Bild vergesse ich nie.
Ich hatte das Glück, bei einer italienischen Familie eine Wohnung zu finden. Ich hatte ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Das war Luxus, verglichen mit vielen anderen. Sie wohnten in Baracken. So Holzbaracken hatte es in Wohlen. Es war brutal, es war kalt dort drinnen. Und die haben dann jahrelang dort geschlafen, auch mit Kindern, auch mit Familie. Ich war schockiert, als ich das sah. Aber so war es. Die Baracken waren in der Nähe vom Friedhof. Reihe an Reihe, sicher 600 bis 700 Leute wohnten dort. Und der, der sie vermietete, wurde natürlich reich.
GROSSE FREUDE. Als die Schwarzenbach-Initiative kam, war ich schon zwei Jahre in der Schweiz. Die Stimmung war angespannt; wir wussten nicht, was mit uns passieren wird. Wir machten Sitzungen, wir Italiener. Viele waren Analphabeten. Ich konnte ihnen erklären, worum es bei dieser Initiative ging. Ich versuchte den Menschen Mut zu machen. Dann kam der Abstimmungssonntag. Ich erinnere mich noch genau. Ich hatte ein Spiel: Wohlen gegen Reinach. Ich stand im Goal, und es hatte einen Haufen Zuschauer. Viele Italiener bibberten – und ich auch im Goal. Trainer Steinmann sagte zu mir: ‹Ich weiss, du bist nervös› und ich sagte: ‹Du, wenn ich heute einen Seich mache, dann ist das nur wegen Schwarzenbach.› Ich habe gebetet. Um drei oder vier Uhr, nach der zweiten Halbzeit, haben wir gehört, dass die Initiative abgelehnt sei. Knapp zwar. Jesses Gott! Nachher habe ich gejubelt!
Wir waren glücklich, natürlich! Das war schon schön. Das gab den Leuten Freude. Die Stimmung gegen die Ausländer besserte sich. Und trotzdem gab es noch immer solche, die uns diskriminierten. Auch ich spürte das, obwohl ich als Goalie vom FC Wohlen beliebt war und akzeptiert wurde. Vordergründig war alles gut, super und so. Aber dann gab es gewisse Momente … und ich war wieder einfach der Tschingg. Das hat mich verletzt, das hat Spuren hinterlassen, ja. Aber später dachte ich: Ich bringe euch etwas. Und das ist mehr als nur meine Arbeitskraft. Wie es Max Frisch sagte: ‹Wir wollten Arbeiter, und dann kamen Menschen.›»
Aufgezeichnet von Daniel Plüss
Redaktion: Patricia D’Incau
Angela Vescio (73) kam 1969 aus Kalabrien nach Bern: «Das war nicht human!»

ANGELA VESCIO: War Fabrikarbeiterin bis 1971, ab 1974 bis zur Pensionierung handwerkliche Mitarbeiterin in einem 100-Prozent-Pensum beim Geographischen Institut der Universität Bern. Ehrenmitglied des Vereins «Casa d’Italia» in Bern, Mitglied der «Comitati degli italiani all’estero» Bern und Neuenburg, Gründerin der Gruppe «Solidarietà donne» in Bern. (Foto: ZVG)
«Ich kam zwei, drei Tage nach meiner Hochzeit in Kalabrien nach Bern. Mein Mann hatte schon hier gearbeitet, also bin ich mit ihm gekommen. Und ich hatte sofort eine Stelle, in der Fabrik Wenger in Gümligen BE.
Ich weiss nicht mehr, wann ich zum ersten Mal von der Schwarzenbach-Initiative gehört habe. Nicht im Radio. Wir Italiener hatten nämlich meistens keins. Denn wir mussten eine Gebühr zahlen, die für uns sehr hoch war. Ich hatte auch Mühe mit Deutsch. In Italien hörte ich immer die Nachrichten, aber in der Schweiz konnte ich das zuerst nicht mehr. Und auf italienisch gab es praktisch nichts. Nicht einmal Bücher.
WAS PROFITIEREN? Viele Leute kamen aus Italien, weil sie keine Arbeit hatten. Weil sie zu Hause keine Zukunft hatten. Aber hier sollten wir keine Gefühle haben. Keine Liebe, nichts. Sondern einfach nur arbeiten und in Baracken schlafen. Es gab keine Sicherheit, viele hatten nur eine Saisonnier-Bewilligung, mussten immer wieder ausreisen. Mama und Papa haben gearbeitet, und die Kinder waren in Italien oder hier versteckt. Das war gar nicht human.
Trotzdem hat Schwarzenbach behauptet, die Italiener würden hier nur profitieren. Taten wir aber nicht! Was profitieren? Wovon soll man profitieren, wenn man zwanzig Stunden unten in einem Loch im Gotthard gearbeitet hat? Und nur gerade genug verdient zum Leben? Was soll man da profitieren? Wir haben den Schweizern doch nichts weggenommen! Die Italiener haben draussen gearbeitet, Schwerarbeit geleistet. Warum wollten sie uns wegschicken? Für mich ist das nicht menschlich. Und wenn Schwarzenbach gewonnen hätte, dann hätten die Schweizer verloren.
Ich habe nie schlecht über die Schweizer gedacht, ich bin jetzt seit
50 Jahren hier. Ich habe Freunde gefunden. Und viele Schweizer haben damals auch nicht verstanden, warum ein Teil der Schweizer zu dieser Initiative Ja gesagt hat.
«Hätte Schwarzenbach gewonnen, hätten die Schweizer verloren.»
GUT GEMACHT! Ich erinnere mich an die Abstimmung. Ich war bei der Arbeit in der Fabrik. Und plötzlich hatten wir keinen Strom mehr. Die Maschinen standen still. Und ich habe zu meiner Vorgesetzten, der Frau Ciana, gesagt: ‹Frau Ciana, das ist der Schwarzenbach, der das gemacht hat.› Und Frau Ciana hat gelacht und gesagt ‹Ja, Angela, das war Schwarzenbach. Er ist wütend, dass er verloren hat.› Ich erinnere mich noch gut.
Bei der ersten Schwarzenbach-Initiative hatte ich weniger Angst als bei der zweiten (1974) und dritten (1977). Da hatte ich mich nämlich von meinem Mann getrennt. Ich war eine arbeitende und alleinerziehende Mutter. Wo sollte ich hin mit drei Kindern? Hier hatte ich Arbeit, eine Bewilligung, ich hatte nie irgendwelche Probleme, ich hatte guten Kontakt mit den Nachbarn.
Aber zum Glück ist das nicht passiert. Das haben sie gut gemacht, die Schweizer Leute. Gut, gut, gut!
Aber leider vergessen wir zu schnell. Heute gibt es den Blocher in der Schweiz und in Italien Salvini … Auch sie wollen die Ausländer wieder draussen haben. Ich verstehe es nicht. Wie können die Menschen die wählen? Für mich wäre das unmöglich. Wir sollten mehr aus der Geschichte lernen.»
Aufgezeichnet von Ava-Katharina Senften
Redaktion: Patricia D’Incau
Guglielmo Grossi (74) kam 1961 als Hilfsarbeiter nach Zürich und wurde politisch aktiv. Später war er Unia-Gewerkschaftssekretär:«Erstmals Einheit»

POLITISCH: Guglielmo Grossi (74) organisierte sich in den «Colonie libere».
«Die Schweizer und die Italiener, das waren getrennte Welten. Am Arbeitsplatz sowieso. Das waren alle Italiener, der Chef ein Schweizer. Aber die Italiener organisierten sich. Es gab zwei starke Organisationen: die Linken und die Katholiken.
Die Linken waren in den ‹Colonie libere italiane›. Sie wurden schon in den 1930er Jahren gegründet. Von Menschen, die vom Faschismus verfolgt wurden und in die Schweiz geflohen waren. Sie organisierten sich zuerst versteckt, weil sie auch hier verfolgt wurden. Und zwar durch Mussolinis diplomatische Vertretung in der Schweiz. 1943 gründete sich die ‹Federazione colonie libere italiane› offiziell, ich wurde später ihr Präsident. Länger im Untergrund blieb aber die Kommunistische Partei Italiens, weil sie in der Schweiz verboten war.
AGITATOREN. Die politisch Aktiven waren vor allem gutqualifizierte Metallarbeiter. Sie kamen in den 1950ern aus dem industriell starken Norden in die Schweiz. Denn damals haben die USA durch ihre Botschafterin in Italien gefordert, dass alle Agitatoren – also die Kommunisten – aus den italienischen Fabriken rausgeworfen werden. Das wurde auch systematisch gemacht. Viele grosse Firmen stellten deshalb gute Berufsleute auf die Strasse oder aber: Sie gaben die Arbeiter den Schweizer Händlern, die in die Fabriken kamen, um die Gutqualifizierten abzuwerben.
EINMALIGE EINHEIT. Die Linken und die katholische Organisation waren eigentlich getrennt. Aber 1970 passierte etwas Wichtiges: Sie haben sich zum ersten Mal zusammengetan wegen der Schwarzenbach-Initiative. Es gab eine grosse Konferenz in Luzern. Diese Versammlung war im Zeichen der Einheit. Und es war das einzige Mal, dass sich die Italienerinnen und Italiener in der Schweiz öffentlich zur Initiative erklärten.»
Aufgezeichnet von Seraina Campell
Redaktion: Patricia D’Incau
Gemma Capone (74) erlebte die Schwarzenbach-Zeit als Fabrikarbeiterin, Mutter und Hausfrau: «Nicht dein Land!»

ALLES GEGEBEN: Gemma Capone (74) chrampfte in der Fabrik und zu Hause.
«Ich wohnte in Rapperswil SG, das war ein sehr offener Ort. Aber insgesamt war die Stimmung in der Schweiz unangenehm. Wie wenn etwas in der Luft wäre. Du hattest das Gefühl, du bist nicht akzeptiert. In Zürich gab es ein Restaurant mit einem Schild: ‹Keine Hunde und Italiener›. Und diese Kämpfe im Fernsehen und dieser Mann, Schwarzenbach … Alles hat gewackelt. Es tat weh.
Wir haben ihre Strassen gebaut, ihre Spitäler, ihre Schulen. Wir sollten gesund sein, wir sollten arbeiten. Wir haben unsere Jugend gegeben für die Produktion. Wir haben viel gegeben. Und doch haben wir immer gespürt: Das ist nicht dein Land. Du hast keine Rechte. Das gehört alles nicht dir. Du bist am falschen Ort.
ARBEITERIN UND MUTTER. Wir haben gearbeitet und waren Hausfrauen mit kleinen Kindern. Ich und eine Nachbarin. Sie hatte Morgenschicht, und ich hatte Nachtschicht. Sie schaute für meine Kinder und ich für ihre. Wir haben uns abgewechselt. So haben wir das gemacht.Es war ein Kampf. Aber die Italiener haben sich organisiert, haben gekämpft für die Rechte. Damals, aber auch später mit der Unia. Für den 13. Monatslohn zum Beispiel. Der Lebensstandard ist besser geworden. Wir haben also nicht nur für uns gekämpft, sondern auch für andere.
Letztes Jahr habe ich einer Lokalzeitung gesagt: ‹Rapperswil ist mein Herz.› Wir sind dankbar. Wir haben ein gutes Leben gehabt, trotz allem. Aber man sollte die Geschichte nicht vergessen. Darum müssen wir auf diese Erfahrung mit Schwarzenbach schauen. Viele Leute wurden verletzt, viele Kinder. Das ist passiert. Das bleibt für immer. Also muss man kämpfen. Denn das darf sich nicht wiederholen.»
Aufgezeichnet von Noëmi Schöb
Redaktion: Patricia D’Incau
Enrique Ros (64) war damals eines der wenigen spanischen Arbeiterkinder:«Die Angst blieb»

«SPANJOGGEL»: Enrique Ros (64) bekam den Rassismus in der Schule zu spüren.
«In der Schule war ich eigentlich immer der einzige Spanier. Und in der Sekundarschule war ich dann das einzige Ausländerkind. Die Lehrer haben mich teilweise nicht einmal mit dem Namen angesprochen. Sondern gesagt: Da, der Spanier dort hinten, und so.
FRANCO-DIKTATUR. Meine Eltern führten das Restaurant Commerce. Hier trafen sich viele Leute, auch aus Kunst und Politik, sowie Spanierinnen und Spanier, die in Bern lebten. Während der Schwarzenbach-Zeit herrschte im Familienbetrieb grosse Angst. Uns Kindern wurde eingetrichtert: ‹Ihr müsst still sein. Ihr müsst lieb sein.› Das Wichtigste war, nicht aufzufallen. Damit die Initiative nicht angenommen wird, damit sie uns nichts machen.
Meine Mutter hat häufig geweint. Es ging ihr schlecht. Sie hat gesagt: ‹Wie können diese Schweizer uns rausschmeissen wollen? Wir haben doch nichts gemacht? Wir arbeiten doch, wir zahlen Steuern. Wenn wir die Koffer packen müssen … Was machen wir denn in Spanien?› Die Verunsicherung war für alle existentiell.
Damals war Spanien unter Franco noch eine Diktatur. Mein Vater wurde dort als junger Mann in ein Konzentrationslager gesteckt. Später habe ich dann realisiert, dass uns ein demokratisches Land wie die Schweiz in eine Diktatur hätte zurückschicken wollen. Das war für mich unglaublich.
NIE VERGESSEN. Als die Schwarzenbach-Initiative abgelehnt wurde, war es eine riesige Erleichterung. Aber es kamen eine zweite und eine dritte Initiative. Und das Gefühl der Angst, der Unsicherheit … es ist nicht weggegangen.
Ob ich mich in der Schweiz zu Hause fühle? Ja, in ganz vielen Sachen schon. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe immer hier gelebt, es geht mir gut. Und doch konnte ich nie vollständig dieses Grundgefühl entwickeln, von: Du gehörst hierhin. Als Kind entwickelte ich ein anderes Bewusstsein: Eigentlich können die mich hier rausschmeissen. Und irgendwie ist das nie ganz weg.»
Aufgezeichnet von Derya Bozat
Redaktion: Patricia D’Incau
Giuseppe Reo (55) war zur Schwarzenbach-Zeit ein Kind. Heute ist er Unia-Regioleiter in der Zentralschweiz und im Berner Oberland: «Wir wohnten in Baracken»

«EN GRUUS»: Unia-Mann Giuseppe Reo (55) musste als Bub zur Fremdenpolizei.
«Wenn du in der Schule ein Brötchen mit Mortadella gegessen hast, wurdest du ausgelacht: ‹Ähhh, en typische huerä Tschinggu!›. Einige Eltern wollten nicht, dass ihre Kinder sich mit uns anfreundeten. Ich erinnere mich an einen guten Kollegen, mit dem ich bis heute Kontakt habe. Seine Mutter hat mir gesagt: Sie wolle nicht, dass ihr Sohn mit einem ‹Tschinggu› verkehre.
Als in Aarberg BE das Kraftwerk gebaut wurde, zügelten wir dorthin. Mein Vater arbeitete dort. Wir wohnten in Baracken, drei Zimmer aneinander. Der zuständige Bauführer dazumal, ganz ein flotter Mann, hat dann dafür gesorgt, dass es einen Durchbruch zwischen den Wänden gab. So hatten wir Zimmer, die durch Schiebetüren verbunden waren.
Gegessen haben wir in der Kantine. Auch die WC und die Duschen waren natürlich draussen. Die teilten sich alle. Wir haben dort einige Jahre gelebt, das war eine relativ harte Zeit.
FREMDENPOLIZEI. Ich kann mich erinnern, wie ich als Bub jeweils zur Fremdenpolizei musste. Das war in Bern, beim Waisenhausplatz. Da kamst du rein, das war eine Riesenhalle mit Holzbänken. Riesig lange Holzbänke. Dort war so ‹en Räche› am Eingang, da musstest du durch, und dann bekamst du einen Zettel.
EINGEPFERCHT. Ich habe diese Halle heute noch vor mir. Mit diesem Zettelchen und dann das grosse Ding an der Wand, das andauernd blätterte und irgendeine Nummer kam. Wir haben manchmal Nachmittage in dieser Wartehalle verbracht. Und wenn deine Nummer kam, wurdest du in ein ‹Kabäuseli›, in ein kleines Zimmerchen, gepfercht wie eine Kuh. Und die fragten dich dort: ‹Was weit er? Wo sit er denn und denn gsii? Was heit er denn und denn gmacht? Ja, wiso sit dr de ned früecher cho?›
Das Ganze war mir jedesmal ‹en Gruus›. Diese Halle … Ja, ich könnte diese Halle heute noch zeichnen.»
Aufgezeichnet von Laura Schleiss
Redaktion: Patricia D’Incau
* Auf fast 350 Seiten haben Geschichtsstudentinnen und -studenten der Universität Bern die Erinnerungen von 14 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen festgehalten. In persönlichen Gesprächen erzählen sie, wie sie die Schwarzenbach-Zeit als Arbeiterinnen und Arbeiter, Kinder oder Nachgeborene erlebt haben. Das Projekt ist Teil eines Seminars anlässlich des 50. Jahrestages der fremdenfeindlichen Schwarzenbach-Abstimmung. Angestossen und geleitet wurde es von der Historikerin, Migrationsforscherin und Dozentin Francesca Falk.